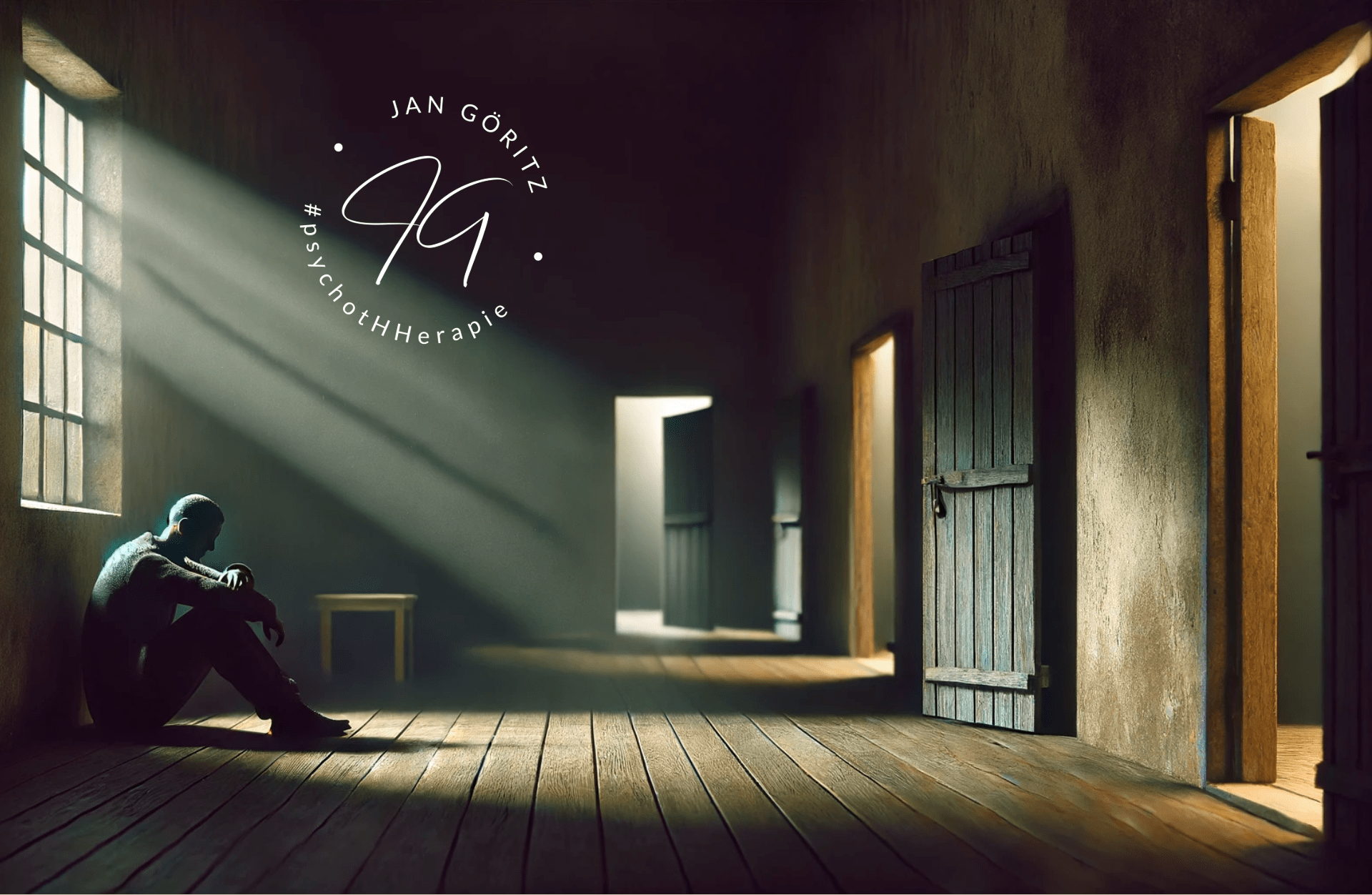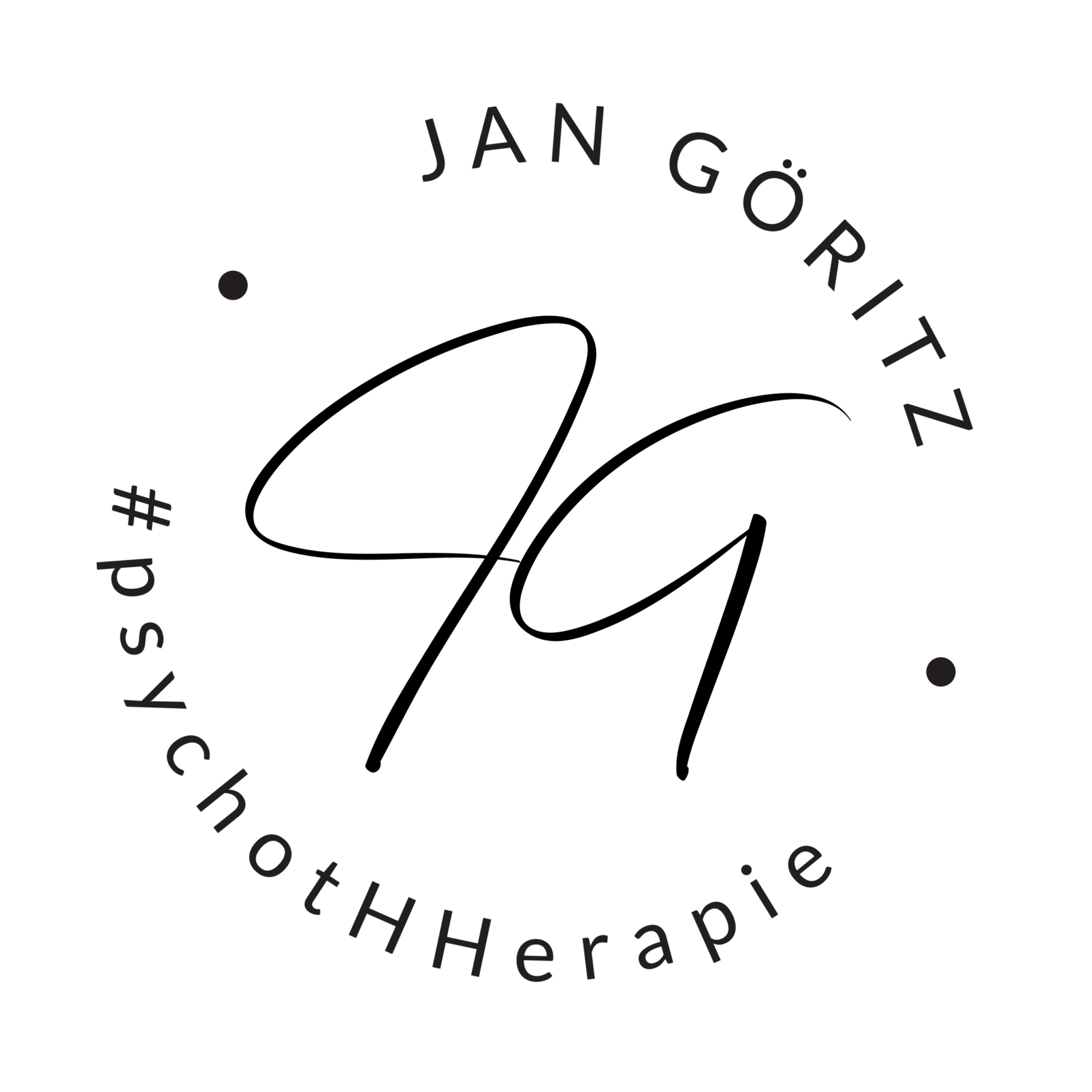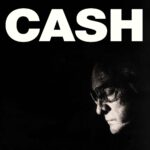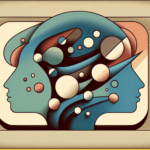„Zwei linke Hände und alles voller Daumen“ – so beurteilt der Großvater den jungen Heinz Strunk in seinem Roman „Fleisch ist mein Gemüse“
Solche Äußerungen hinterlassen natürlich deutliche Spuren auf der Psyche eines Menschen und können zu dem führen, was man „erlernte Hilflosigkeit“ nennt.
Doch was ist erlernte Hilflosigkeit überhaupt?
Was ist erlernte Hilflosigkeit?
In meiner Praxis begegnen mir immer wieder Menschen, die unter ihrer derzeitigen Lebenssituation leiden, aber nicht in der Lage sind, kleine Veränderung vorzunehmen, geschweige denn einen Ausweg zu sehen,
Mitunter betrachten Sie sich als „Pechvögel“ oder als „verflucht“.
Beide Betrachtungsweisen beschreiben das vorherrschende Gefühl der Hilflosigkeit sehr gut.
Beispiel aus der Praxis
So erlebte es auch eine ehemalige Klientin von mir, die sich aufgrund akuter Erschöpfung an mich gewandt hat.
Sie berichtete mir, dass sie zwei kleine Kinder im Alter von drei und fünf Jahren hat und sich seit der Geburt des zweiten Kindes permanent überfordert und zunehmend kraftlos fühlt.
So, wie sie mir gegenüber saß, wirkte sie, als wäre sie in sich selbst zusammengefallen.
Auf meine Frage, wie sie denn war, bevor sie Kinder hatte, berichtete sie mir von einem Menschen, den ich mit der vor mir sitzenden Frau nur schwer übereinkriegen konnte.
Lebenslustig sei sie gewesen, kraftvoll und erfolgreich in der Werbeagentur und im privaten neugierig und lebenshungrig. Viel gereist sei sie und hätte kein Abenteuer und keine Party ausgelassen.
Dann hat sie ihren jetzigen Mann kennen gelernt und ist relativ schnell Mutter geworden.
Sie sitzt mir gegenüber, und ich kann ihr ansehen, dass sie innerlich in die Zeit vor gut fünf Jahren zurück gereist ist, um zu erinnern, wie es ihr damals ging.
Als sie wieder ins Hier und Jetzt zurückgekehrt ist, hat sie eine Erkenntnis mitgebracht.
„Herr Göritz, bevor ich meinen Mann kennen gelernt habe, war ich lange Single. Da musste ich nur im Job perfekt performen. Und dann musste ich plötzlich noch die perfekte Partnerin und die perfekte Mutter sein. Vielleicht war das zu viel für mich..“ sagte sie mit Tränen in den Augen.
„Ganz schön viel ‚perfekt‘“ erwidere ich.
Da brachen die Tränen endgültig durch, und sie berichtete von strengen Eltern, bei denen nur Leistung zählte und bei denen Fehler und Schwäche hart bestraft wurden.
So hat sie schließlich den Weg eingeschlagen, es allen recht zu machen, um niemanden zu enttäuschen und darüber hinaus begonnen, ihre Bedürfnisse zu vernachlässigen und ihre Gefühle zu unterdrücken. Irgendwann hat sich in ihrem Hamsterrad gefangen gefühlt und keine Idee mehr davon hatte, dass sie selber etwas in ihrem Leben verändern könnte.
Wie stark Erfahrungen aus der Kindheit wirken können, habe ich in dem Artikel „An der Kette“ beschrieben.
Wer prägte den Begriff „erlernte Hilflosigkeit“?
Der Begriff „erlernte Hilflosigkeit“ wurde von dem US-amerikanischen Psychologen Martin Seligman geprägt.
Er führte in den 1960er Jahren Versuche mit Hunden durch, um dem Phänomen „erlernte Hilflosigkeit“ auf die Spur zu kommen.
Seligmans Experiment mit Hunden
Martin Seligmans Experiment aus den 1960er Jahren bietet eine tiefe Einsicht in das Phänomen der erlernten Hilflosigkeit. Er führte sein Experiment in zwei Phasen durch, um die Auswirkungen von Kontrollverlust auf das Verhalten zu untersuchen.
In der ersten Phase setzte Seligman eine Gruppe von Hunden wiederholt unkontrollierbaren elektrischen Schlägen aus. Diese Hunde wurden in zwei Gruppen unterteilt.
Die Hunde der ersten Gruppe hatten die Möglichkeit, den Elektroschocks zu entkommen, indem sie einen Schalter betätigten, der die Schläge stoppte. Die Hunde der zweiten Gruppe erlebten dieselben Schläge, jedoch ohne die Möglichkeit, sie durch eine Handlung zu beeinflussen. Egal, was diese Hunde versuchten, sie konnten die Schocks nicht abstellen, was zu einem Gefühl der Hilflosigkeit führte.
In der zweiten Phase des Experiments brachte Seligman die Hunde in eine sogenannte Shuttle-Box, eine Vorrichtung mit zwei Kammern, die durch eine kleine Öffnung miteinander verbunden sind. Hier kündigte ein Signalton das Einsetzen der Elektroschocks an. Die Hunde aus der ersten Gruppe, die gelernt hatten, durch ihr Verhalten die Schocks zu vermeiden, reagierten schnell auf den Ton und wechselten in die andere Kammer, um den Schlägen zu entkommen.
Sie zeigten eine aktive Fluchtreaktion und vermieden die Schocks oft vollständig, indem sie frühzeitig die Kammer wechselten.
Die Hunde der zweiten Gruppe, die gelernt hatten, dass ihre Handlungen keinen Einfluss auf die Schocks hatten, blieben hingegen passiv. Sie versuchten nicht, den Stromstößen zu entkommen, obwohl sie jetzt die Möglichkeit dazu hatten.
Diese Hunde hatten durch ihre vorherigen Erfahrungen gelernt, dass sie hilflos waren, und zeigten daher keine Fluchtreaktionen mehr.
Dieses Experiment verdeutlicht, wie wiederholte Erfahrungen der Unkontrollierbarkeit zu einem Zustand der erlernten Hilflosigkeit führen können, bei dem Individuen passiv bleiben, selbst wenn sie die Möglichkeit haben, ihre Situation zu ändern. Dieses Konzept lässt sich auch auf menschliches Verhalten übertragen und erklärt, warum manche Menschen trotz vorhandener Lösungen keine aktiven Schritte unternehmen, um ihre Lage zu verbessern.
Erlernte Hilflosigkeit – woran kann man sie erkennen?
Erlernte Hilflosigkeit kann sich auf verschiedene Arten und Weisen ausbilden und tiefe Auswirkungen auf das Leben des betroffenen Menschen haben.
Ich habe fünf Anzeichen zusammengestellt, die darauf hinweisen können, dass jemand unter dem Phänomen „erlernte Hilflosigkeit“ leidet:
- Passivität und Resignation Da Menschen, die erlernte Hilflosigkeit ausgebildet haben, in ihrem Leben häufig die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Bemühungen erfolglos bleiben, unternehmen sie kaum noch aktive Schritte, um ihre Situation zu verändern. Aus Resignation wird Passivität.
- Geringes Selbstwertgefühl Betroffene Menschen haben häufig verinnerlicht, dass sie selber „lebensunfähig“ sind. Dieses negative Selbstbild resultiert aus der Erfahrung, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Lebensumstände zu verbessern oder ihre Probleme zu lösen. Das Selbstbild verstärkt sich mit jeder neuen Erfahrung dieser Art.
- Negative Erwartungshaltung Da wir Menschen dazu neigen, aus unseren vergangenen Erfahrungen einen Rückschluss auf die Zukunft zu ziehen, haben Menschen mit vielen negativen Erfahrungen, auch eine negative Erwartungshaltung bezüglich zukünftiger Ereignisse. Dadurch gehen Sie Herausforderungen häufig aus dem Weg und werden „blind“ für sich bietende Möglichkeiten.
- Verminderte Fähigkeiten, Probleme zu lösen Betroffene haben häufig Schwierigkeiten, effektive Strategien zu entwickeln, um mit Herausforderungen und Problemen umzugehen. Sie fühlen sich oft überfordert und unfähig, selbst einfacher Probleme zu lösen. Daraus resultiert Resignation und weiterer Rückzug.
- Emotionale Reaktionen wie Depression und Angst durch die mit erlernter Hilflosigkeit einhergehende Hoffnungslosigkeit erleben Betroffene Menschen, häufig starke Gefühle von Traurigkeit und Angst. Diese wiederum können ihrerseits die Hoffnungslosigkeit verstärken.
Teil 2 „Erlernte Selbstwirksamkeit “ finden Sie hier.